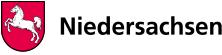Geschlechterbewusste Sprache
Sprache formt unsere Wahrnehmung. Und Wahrnehmung formt unsere Wirklichkeit. Sprache befindet sich dabei in ständigem Wandel und ermöglicht gesellschaftliche Veränderungen. Deshalb legt die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung (LpB) großen Wert auf geschlechterbewusste Sprache.
Was haben Geschlecht, Sprache und gesellschaftlicher Wandel miteinander zu tun?
Geschlecht ist ein soziales Konstrukt. Das heißt: Individuum und Gesellschaft schreiben Geschlechtern eine Bedeutung zu. Bei der Konstruktion von Geschlecht spielen also persönliche und gesellschaftliche Faktoren genauso wie deren Wechselwirkung eine große Rolle.
Viele Gesellschaften sind geprägt durch die Vorstellung von ausschließlich zwei Geschlechtern: Mann und Frau. Diese Annahme nennt man binäres Geschlechtermodell. Den Geschlechtern werden in diesem binären (zweiteiligen) Modell bestimmte Rollen zugeschrieben, also gesellschaftliche Vorstellungen und Erwartungen, wie Frauen und Männer vermeintlich sind oder sein sollten. Sätze wie: „Jungs mögen Blau und spielen gerne mit Autos“, oder: „Mädchen mögen Rosa und spielen gerne mit Puppen“, prägen uns schon in der Kindheit.
Binäre Geschlechtervorstellungen haben daher einen großen Einfluss auf unsere Erziehung, unsere Persönlichkeitsentwicklung und auch auf unsere Perspektiven sowie Chancen im Leben. Sie können Menschen darin einschränken, sich selbst und andere unabhängig von diesen Rollenvorstellungen zu identifizieren und zu verstehen. Menschen, die nicht in die binären Geschlechterrollen passen oder passen wollen, werden oft ausgeschlossen – sowohl sprachlich als auch gesellschaftlich.
Warum geschlechterbewusste Sprache?
In einigen Sprachen, auch im Deutschen, verwenden Menschen beim Sprechen über andere Menschen das generische Maskulinum. Dabei wird die männliche Form eines Wortes für alle Menschen gleichermaßen verwendet – scheinbar allgemeingültig und geschlechtsneutral, selbst wenn sich nicht alle davon angesprochen fühlen. Frauen und Menschen mit Geschlechtern, die nicht dem binären Modell entsprechen, werden jedoch ausgeschlossen oder zumindest nicht explizit eingeschlossen. Das hat Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung: So denken beispielsweise die meisten Menschen bei der Berufsbezeichnung „Arzt“ an eine männliche Person.
Geschlechterbewusste Sprache soll deshalb bewusst machen, welche gesellschaftlichen Denkmuster und Vorstellungen von Geschlechterrollen sich in unsere Sprache eingeschrieben haben. Außerdem sind Vielzahl und Vielfalt von Geschlechtern in unserer Sprache im Alltag bisher nicht deutlich geworden. Auch hier kann geschlechterbewusste Sprache ein neues Bewusstsein für Geschlechtervielfalt schaffen und die Wahrnehmung verändern.
Die LpB hat den Auftrag, für alle Menschen in Niedersachsen Angebote zu erstellen. Geschlechterbewusste Sprache ist ein Ausdruck unserer Bemühungen, diesem Auftrag gerecht zu werden. Sie ist ein Ansatz, um möglichst viele Menschen in Niedersachsen zu erreichen.
Wie nutzt die LpB geschlechterbewusste Sprache?
Es gibt zahlreiche Arten, sich geschlechterbewusst auszudrücken. Die LpB nutzt den Gender-Gap. Der Gender-Gap ist eines der sogenannten Genderzeichen. Andere sind zum Beispiel das Gendersternchen (*) oder der Gender-Doppelpunkt.
Der Gender-Gap ist im Schriftlichen ein Unterstrich zwischen dem männlichen Wortstamm und der weiblichen Endung eines Wortes. So entsteht aus dem Wort „Politiker“ die Schreibweise „Politiker_in“. Im Gesprochenen verdeutlicht eine kleine Sprechpause an der Stelle des Gender-Gaps, dass Menschen aller Geschlechter gemeint sind.
Der Gender-Gap lässt also eine symbolische Lücke zwischen der männlichen und der weiblichen Form eines Wortes. Er eröffnet den Raum für Geschlechtervielfalt. Dabei haben Genderzeichen auch eine politische Funktion: Indem sie stören oder irritieren, sollen sie zum Nachdenken anregen und zum Hinterfragen der Binarität von Mann und Frau ermutigen.
Geschlechterbewusste Sprache kann also helfen, unser Denken zu verändern. Indem wir „Liebe Leser_innen“ anstatt „Lieber Leser“ schreiben, zeigen wir, dass die LpB Menschen aller Geschlechter mitdenkt, meint und auch explizit anspricht.
Was bedeutet (sie/ihr), (er/ihm) oder (keine Pronomen) hinter unseren Namen in der E-Mail-Signatur?
Neben der Verwendung des Gender-Gaps machen wir bei der LpB unsere persönlichen Pronomen in der E-Mail-Signatur kenntlich. Lange gab es in der deutschen Sprache keine Pronomen, welche die Vielfalt der Geschlechter widerspiegeln. Mittlerweile existieren jedoch einige Möglichkeiten, die unter anderem nicht-binäre Personen nutzen. Nicht-binär ist eine mögliche Selbstbezeichnung von Menschen, die im binären Geschlechtermodell keinen Platz finden.
Manche Menschen nutzen für sich Pronomen wie „dey/deren“ oder „they/them“. Manche Menschen wiederum nutzen alle oder gar keine Pronomen. Dann wird schlicht der Name der Person verwendet, wenn man sich auf sie bezieht. Bei der direkten Ansprache kann in diesem Fall statt „Frau Nachname“ oder „Herr Nachname“ einfach „Vorname Nachname“ gesagt werden.
Wir legen jedenfalls großen Wert darauf, die unterschiedlichen Pronomen aller Menschen zu respektieren. Auch das gehört für uns in der LpB zu einer geschlechterbewussten Sprache.